
In vielen Großstädten herrscht Wohnungsmangel, in kleineren Gemeinden gibt es dagegen Leerstände. Der Zensus kann dazu beitragen, diese Herausforderungen transparenter anzugehen. Denn er erfasst nicht nur wie viele Leute in Deutschland leben, sondern auch wo und wie.
Erstmals seit 2011 wieder flächendeckende Zahlen zur Verteilung von Wohnraum
Der deutschlandweite Zensus 2022 ist unterteilt in eine Bevölkerungszählung und eine Gebäude- und Wohnungszählung. Bei der Erfassung aller Wohngebäude und Wohnungen werden alle Haus- und Wohnungseigentümerinnen und -eigentümer befragt – das sind etwa 23 Millionen Menschen in Deutschland. „Die Gebäude- und Wohnungszählung des Zensus liefert flächendeckende Zahlen zur Verteilung von Wohngebäuden und Wohnungen. Neben Größe und Alter, auch zum ersten Mal Daten zur Nettokaltmiete sowie dem Leerstand und den Gründen dafür“, erklärt Stefan Dittrich, fachlicher Projektleiter des Zensus 2022 beim Statistischen Bundesamt.
Bundesweite Daten zu Bestandsmieten
Die neuen Daten des Zensus 2022 kommen dem zunehmenden Bedarf nach bundesweit vergleichbaren kommunalen Mietspiegeln entgegen. Der Zensus gibt damit einen umfassenden Überblick über die Höhe der Bestandsmieten in ganz Deutschland. Außerdem können die Ergebnisse zum Leerstand für betroffene Kommunen erstmals detailliert aufzeigen, wie lange ein Leerstand andauert und welche Gründe insbesondere für längeren Leerstand vorliegen.
Darüber hinaus bietet die Erfassung aller Gebäude und Wohnungen in Kombination mit den erhobenen Informationen zu Haushalten und Familien die Möglichkeit, die Wohnsituation von Haushalten und Familien auszuwerten. Zum Beispiel kann ermittelt werden, welche Größe die Wohnungen haben, die von Einpersonenhaushalten oder Familien bewohnt werden und ob es sich um Ein- oder Mehrfamilienhäuser handelt. Durch die Ergebnisse des Zensus 2022 ist damit erstmals eine regionale Auswertung der durchschnittlichen Miethöhe für die unterschiedlichen Haushaltstypen und -größen möglich.
Der Zensus liefert Datengrundlage zur Energieeffizienz in Deutschland
Auch zum Thema Energieeffizienz liefert der Zensus 2022 Daten: Durch die Struktur der Gebäude nach Baujahr und Energieträger der Heizung kann eine umfassende Momentaufnahme der derzeit genutzten Energieträger erstellt werden. Diese kann beispielsweise künftige Planungen zur erwarteten Altbausanierung und damit zu erwartenden Förderumfängen unterstützen, aber auch generell Hinweise zur Energieeffizienz der Gebäudesubstanz im Bestand liefern.
„Damit liefert der Zensus wichtige Daten zum Thema Wohnen in Deutschland, die Planungsgrundlage für die staatliche und kommunale Wohnungspolitik der Zukunft sind“, fasst Stefan Dittrich vom Statistischen Bundesamt zusammen.
(Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell)











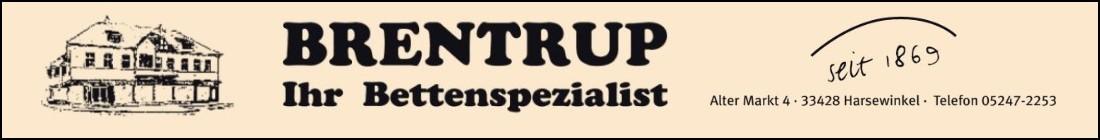



















 Wir bei
Wir bei 







 Am Samstag war NRW-Staatssekretär Klaus Kaiser, der im Landesministerium für Kultur und Wissenschaft u. a. die Fördermittel der „Dritten Orte“ Projekte verantwortet, im Kulturort Wilhalm in Harsewinkel zu Gast. Nach der pandemiebedingten Zwangspause war es für ihn an der Zeit, sich persönlich einen Eindruck vom Status des u. a. mit Fördermitteln des Landes finanzierten Projekts zu verschaffen. Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide und Micky Grohe, der Kulturbeauftragte der Stadt Harsewinkel, nahmen den Staatssekretär in Anwesenheit von Vertretern des „Team Wilhalm“, des KuBi und der Ratsfraktionen von SPD, Grünen, CDU und FDP mit Musik der Ständchen-Kapelle des Kolpingorchesters im Schankraum in Empfang und begleiteten ihn anschließend auf einem ausgedehnten Rundgang durch den neugestalteten Wilhalm.
Am Samstag war NRW-Staatssekretär Klaus Kaiser, der im Landesministerium für Kultur und Wissenschaft u. a. die Fördermittel der „Dritten Orte“ Projekte verantwortet, im Kulturort Wilhalm in Harsewinkel zu Gast. Nach der pandemiebedingten Zwangspause war es für ihn an der Zeit, sich persönlich einen Eindruck vom Status des u. a. mit Fördermitteln des Landes finanzierten Projekts zu verschaffen. Bürgermeisterin Sabine Amsbeck-Dopheide und Micky Grohe, der Kulturbeauftragte der Stadt Harsewinkel, nahmen den Staatssekretär in Anwesenheit von Vertretern des „Team Wilhalm“, des KuBi und der Ratsfraktionen von SPD, Grünen, CDU und FDP mit Musik der Ständchen-Kapelle des Kolpingorchesters im Schankraum in Empfang und begleiteten ihn anschließend auf einem ausgedehnten Rundgang durch den neugestalteten Wilhalm.









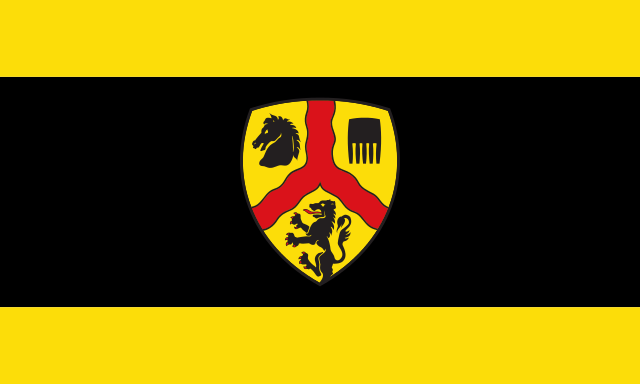
 Das neue
Das neue 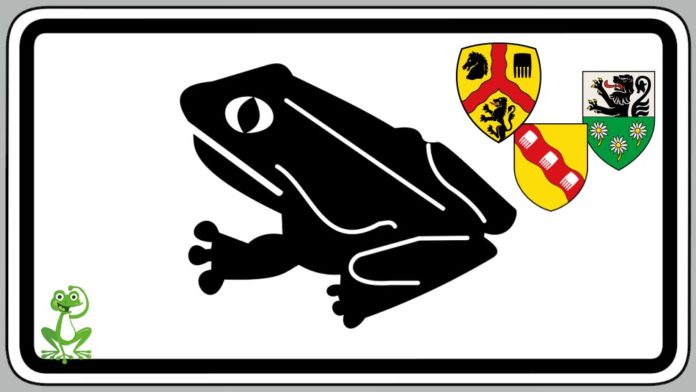
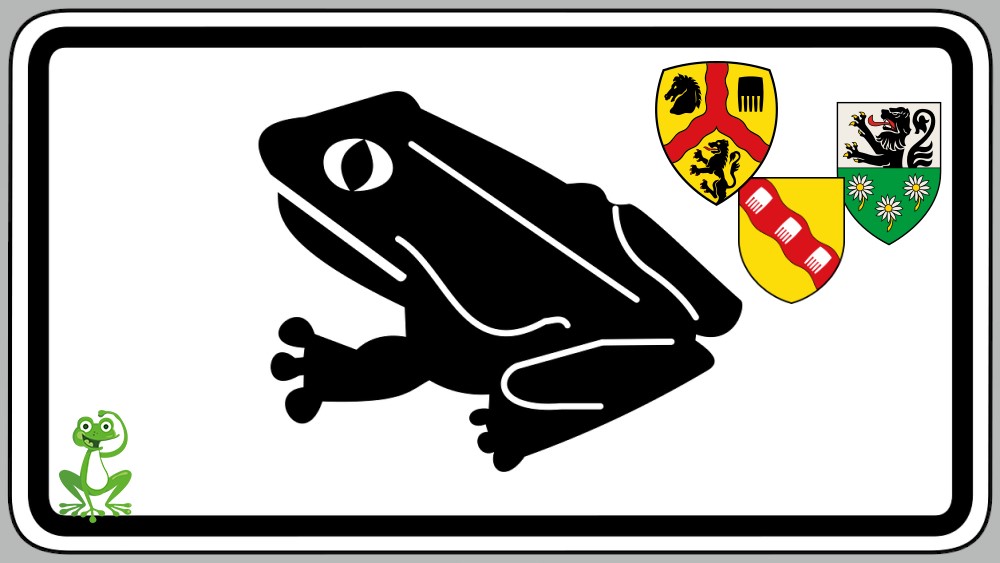 Aufgrund von Krankheitsausfällen sucht die Stadt Harsewinkel kurzfristig noch Amphibienschützer, die an mehreren Tagen im März den Schutz der Tiere durch deren Absammeln an den Schutzzäunen der Hesselteicher und der Steinhäger Straße gewährleisten.
Aufgrund von Krankheitsausfällen sucht die Stadt Harsewinkel kurzfristig noch Amphibienschützer, die an mehreren Tagen im März den Schutz der Tiere durch deren Absammeln an den Schutzzäunen der Hesselteicher und der Steinhäger Straße gewährleisten.
 Rund 10,6 Millionen Ausländerinnen und Ausländer lebten Ende 2020 in Deutschland. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, hatte somit gut jeder zehnte hierzulande lebende Mensch zum Stichtag 31.12.2020 keine deutsche Staatsbürgerschaft (12,7 %). Mit einem Anteil von 12,4 % an der ausländischen Bevölkerung insgesamt bildeten Türkinnen und Türken die größte Gruppe (1,3 Millionen Menschen). Dahinter folgten syrische (787 000 oder 7,4 %) und polnische (774 000, 7,3 %) Staatsangehörige.
Rund 10,6 Millionen Ausländerinnen und Ausländer lebten Ende 2020 in Deutschland. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, hatte somit gut jeder zehnte hierzulande lebende Mensch zum Stichtag 31.12.2020 keine deutsche Staatsbürgerschaft (12,7 %). Mit einem Anteil von 12,4 % an der ausländischen Bevölkerung insgesamt bildeten Türkinnen und Türken die größte Gruppe (1,3 Millionen Menschen). Dahinter folgten syrische (787 000 oder 7,4 %) und polnische (774 000, 7,3 %) Staatsangehörige.



 Das was? Na, das Spöggsken!
Das was? Na, das Spöggsken!