Das Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ ist mit bundesweit 3.500 Schulen eines der größten deutschen Schulnetzwerke. Die teilnehmenden Schulen engagieren sich freiwillig in regelmäßigen Aktionen und Projekten gegen Ausgrenzung, Diskriminierung und Rassismus. Um diese Arbeit in Nordrhein-Westfalen fortzusetzen und weiter zu vertiefen, hat die Landesregierung beschlossen, das Programm „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ weiterhin zu unterstützen. Dafür wurde mit den Kooperationspartnern vom DGB-Bildungswerk NRW und der GEW NRW eine neue Kooperationsvereinbarung bis Dezember 2025 unterzeichnet.
Mit der neuen Kooperationsvereinbarung unterstützt die Landesregierung die wichtige Arbeit des Netzwerks „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ und baut sowohl die finanziellen als auch die personellen Ressourcen weiter aus. Getragen wird das Projekt von dem Engagement der beteiligten Courage-Schulen, gemeinsam mit den Kooperationspartnern schafft das Schulministerium die Rahmenbedingungen.
Anja Weber, Vorsitzende DGB Bildungswerks NRW und DGB NRW: „Der allgegenwärtige Rassismus und aufkommende Verschwörungstheorien zeigen uns, wie wichtig eine umfassende politische Bildung an Schulen ist. Schüler*innen müssen gegen alle Formen der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit und für Courage gestärkt werden. Unsere Demokratie lebt vom Mitmachen, von Solidarität und Menschlichkeit. Im Netzwerk ‚Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage‘ engagieren sich Schüler*innen mit ihren Lehrkräften und Schulsozialarbeitenden gegen Diskriminierung und Rassismus vor Ort. Das DGB-Bildungswerk NRW übernimmt mit seinen Fortbildungsangeboten für pädagogisch Tätige im Bereich der Menschenrechtsbildung und Demokratieerziehung und die DGB-Jugend NRW mit der Courage-Trainer*innen-Ausbildung für Schüler*innen Mitverantwortung für politische Bildung. Die Fortsetzung der bewährten Kooperation mit der Landeskoordination Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage, mit dem Schulministerium, der GEW NRW und dem DGB-Bildungswerk NRW ist ein wichtiges Signal für die Demokratie in Nordrhein-Westfalen.“
Ayla Celik, stellvertretende Vorsitzende der GEW NRW: „Herzlichen Glückwunsch dem Netzwerk und den teilnehmenden Schulen. Gerne sind wir seit Jahren Kooperationspartner für ‚Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage‘. Die Verlängerung der Kooperationsvereinbarung ist in Zeiten von zunehmendem Rechtspopulismus, in denen menschenverachtende Äußerungen Konjunktur zu haben scheinen, ein wichtiges Signal. So werden Schulen, die hin- und nicht wegschauen, weiterhin gut unterstützt.“
Die neue Kooperationsvereinbarung tritt am 1. August dieses Jahres in Kraft. Das Schulministerium stellt ab 2021 jährlich 45.000 Euro (bislang: 30.000 Euro) für Sachmittel, u.a. für Info-Flyer und Plakate, bereit. Außerdem finanziert das Schulministerium künftig insgesamt vier Lehrerstellen (bislang: 2,5 Lehrerstellen) zur Landeskoordination des Netzwerks „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“. Das DGB-Bildungswerk NRW bildet die Lehrkräfte der beteiligten Schulen insbesondere zur Prävention von Rassismus und Diskriminierung fort. In jedem Schulhalbjahr werden Fortbildungen zu Themen der Demokratiebildung, zur Stärkung der Zivilcourage, zur Prävention und Intervention menschenfeindlicher Haltungen sowie zu rassismuskritischen Fragestellungen angeboten. Die GEW NRW wird darüber hinaus eine jährliche Fachtagung zu einer rassismuskritischen, demokratiebildenden oder interkulturellen Thematik anbieten.
Ziel der vertieften Zusammenarbeit ist, die beteiligten Schulen in ihrem Engagement gegen Diskriminierung und Rassismus noch enger zu begleiten und zu beraten. Außerdem sollen die Zusammenarbeit der Schulen untereinander sowie mit außerschulischen Partnern gefördert und weitere Schulen in das Netzwerk aufgenommen werden.
Mehr Informationen zum Netzwerk finden Sie hier: https://www.schule-ohne-rassismus.org/
(Text- und Bildquelle: Land NRW)











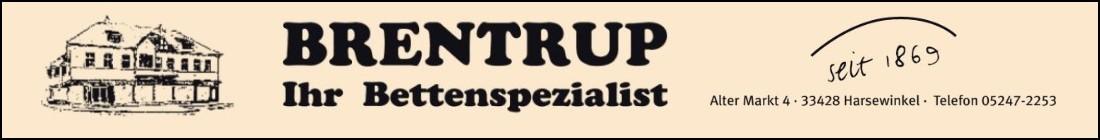




















 Wenig Verkehr und leere Fernstraßen: Davon können Autofahrer an den kommenden 13 Wochenenden nur träumen. In Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein fällt an diesem Wochenende der Startschuss zu den Sommerferien. In Richtung Meer oder in den Süden unterwegs sind aber auch Autourlauber aus Nordeuropa sowie Reisende, die nicht an Ferientermine gebunden sind. Endloslange Blechlawinen erwartet der ADAC zum Saisonauftakt auf den Ferienautobahnen noch nicht.
Wenig Verkehr und leere Fernstraßen: Davon können Autofahrer an den kommenden 13 Wochenenden nur träumen. In Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein fällt an diesem Wochenende der Startschuss zu den Sommerferien. In Richtung Meer oder in den Süden unterwegs sind aber auch Autourlauber aus Nordeuropa sowie Reisende, die nicht an Ferientermine gebunden sind. Endloslange Blechlawinen erwartet der ADAC zum Saisonauftakt auf den Ferienautobahnen noch nicht.
 Infolge einer raucherspezifischen Erkrankung wurden in Deutschland im Jahr 2019 insgesamt 458 000 Patientinnen und Patienten im Krankenhaus behandelt, davon waren 57 % Männer. Damit ist die Zahl solcher vollstationären Behandlungen im Vergleich zu 2010 um 18 % gestiegen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Weltnichtrauchertages am 31. Mai mitteilt. 211 300 dieser Fälle waren auf einen Lungen- und Bronchial-, Kehlkopf- oder Luftröhrenkrebs zurückzuführen, 246 700 auf eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD). Die behandelten Patientinnen und Patienten waren im Durchschnitt 67,3 Jahre (Krebsdiagnosen) beziehungsweise 70,5 Jahre (COPD) alt.
Infolge einer raucherspezifischen Erkrankung wurden in Deutschland im Jahr 2019 insgesamt 458 000 Patientinnen und Patienten im Krankenhaus behandelt, davon waren 57 % Männer. Damit ist die Zahl solcher vollstationären Behandlungen im Vergleich zu 2010 um 18 % gestiegen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anlässlich des Weltnichtrauchertages am 31. Mai mitteilt. 211 300 dieser Fälle waren auf einen Lungen- und Bronchial-, Kehlkopf- oder Luftröhrenkrebs zurückzuführen, 246 700 auf eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD). Die behandelten Patientinnen und Patienten waren im Durchschnitt 67,3 Jahre (Krebsdiagnosen) beziehungsweise 70,5 Jahre (COPD) alt.


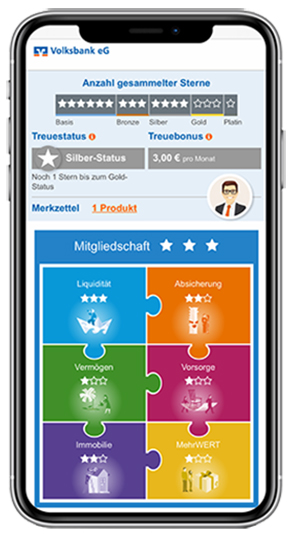

 Moderna wird bis auf weiteres im Impfzentrum im Kreis Gütersloh verimpft. Anfang Juni hieß es seitens des Kreises, dass der Impfstoff nur in der Woche vom 7. bis 13. Juni im Impfzentrum verimpft wird. Das Land Nordrhein-Westfalen, das den Impfstoff zuteilt, hatte zuvor eine entsprechende Ankündigung gemacht. Moderna ist ein mRNA-Impfstoff, welcher vergleichbar ist mit dem von BioN-Tech. Grundsätzlich gilt, dass es beim Impfstoff keine Wahlmöglichkeiten gibt.
Moderna wird bis auf weiteres im Impfzentrum im Kreis Gütersloh verimpft. Anfang Juni hieß es seitens des Kreises, dass der Impfstoff nur in der Woche vom 7. bis 13. Juni im Impfzentrum verimpft wird. Das Land Nordrhein-Westfalen, das den Impfstoff zuteilt, hatte zuvor eine entsprechende Ankündigung gemacht. Moderna ist ein mRNA-Impfstoff, welcher vergleichbar ist mit dem von BioN-Tech. Grundsätzlich gilt, dass es beim Impfstoff keine Wahlmöglichkeiten gibt.
 Die TSG-Fußballer der F1 freuen sich über neue Trainingsanzüge und möchten sich an dieser Stelle ganz herzlich bei Christian Grandek, dem Geschäftsführer der Neleon GmbH „Produktfotografie und Bildbearbeitung“ bedanken. Schon zum zweiten Mal unterstützt das Gütersloher Unternehmen die Mannschaft von Trainer Simon Wittenbrink mit einer großzügigen Spende. Die Kinder des Jahrgangs 2012 waren die einzige Mannschaft der TSG, die auch unter strengsten Corona-Auflagen im Frühjahr das Training fortsetzte. Daher brennen die Jungs auch darauf, sich endlich wieder mit anderen Teams im Wettkampf messen zu dürfen. Mit den neuen Trainingsanzügen ist jetzt auch ein geschlossenes Auftreten in optischer Hinsicht gewährleistet.
Die TSG-Fußballer der F1 freuen sich über neue Trainingsanzüge und möchten sich an dieser Stelle ganz herzlich bei Christian Grandek, dem Geschäftsführer der Neleon GmbH „Produktfotografie und Bildbearbeitung“ bedanken. Schon zum zweiten Mal unterstützt das Gütersloher Unternehmen die Mannschaft von Trainer Simon Wittenbrink mit einer großzügigen Spende. Die Kinder des Jahrgangs 2012 waren die einzige Mannschaft der TSG, die auch unter strengsten Corona-Auflagen im Frühjahr das Training fortsetzte. Daher brennen die Jungs auch darauf, sich endlich wieder mit anderen Teams im Wettkampf messen zu dürfen. Mit den neuen Trainingsanzügen ist jetzt auch ein geschlossenes Auftreten in optischer Hinsicht gewährleistet.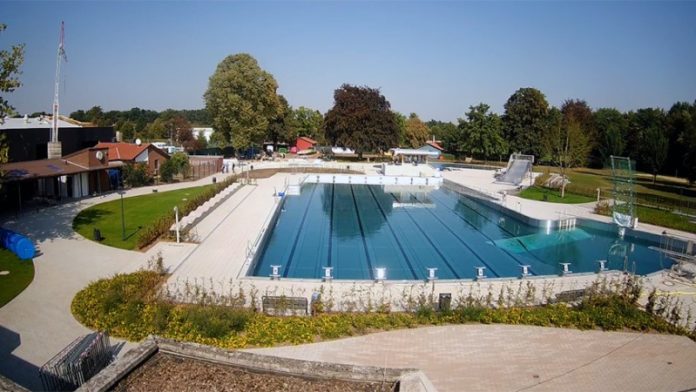





 Das was? Na, das Spöggsken!
Das was? Na, das Spöggsken!