Sabine Leutheusser-Schnarrenberger: „Das Jahr 2020 war sowohl in der Präventionsarbeit als auch bei antisemitischen Vorfällen von der Corona-Pandemie geprägt. Viele geplante Projekte, Veranstaltungen, Besuche und Termine mussten verschoben werden. Gleichzeitig hat sich die Pandemie-Situation zu einem Nährboden für einfache Erklärungsmuster und Verschwörungsmythen entwickelt. Dabei wird auf Muster zurückgegriffen, nach denen ‚finstere Hintergrundmächte‘ für das Unheil oder die Krise verantwortlich seien. Die Gruppierungen, die als solche dunklen Mächte ausgemacht werden, sind dabei austauschbar, jedoch sind diese Mythen fast immer antisemitisch konnotiert.“
Auch bei den sogenannten „Querdenker“-Demonstrationen, so Leutheusser-Schnarrenberger, wurde 2020 der antisemitische Terror der NS-Zeit relativiert und verharmlost, indem sich etwa „besorgte Bürger“ wegen der Beschränkung ihrer Grundrechte mit Anne Frank oder Sophie Scholl und der weißen Rose vergleichen und sich im Widerstand gegen eine Diktatur wähnen. „Besonders problematisch an den Hygiene- und Querdenker-Demonstrationen ist, dass sich erstmals Milieus der gesellschaftlichen Mitte mit Rechtsextremisten vereint haben. Reichsbürger, Wutbürger, völkische Siedler liefen neben Impfgegnern, Esoterikern und ökologisch-alternativ Lebenden auf den Corona-Protesten“, so Leutheusser-Schnarrenberger. „Dass der Verfassungsschutz inzwischen bundesweit Personen und Gruppen in der ‚Querdenker‘“-Bewegung beobachtet, ist angesichts der Parolen und teilweisen Vernetzung in rechtsextreme Bereiche nur konsequent.“
Vor diesem Hintergrund sei die leicht rückläufige Entwicklung bei der Zahl antisemitischer Straftaten im Bereich der politisch motivierten Kriminalität im Land Nordrhein-Westfalen „kein Grund zur Entwarnung“, so Leutheusser-Schnarrenberger. „Die Geschehnisse um die Demonstrationen sowie Erkenntnisse aus der durch die Antisemitismusbeauftragten initiierten und im September 2020 vorgestellten RIAS-Problembeschreibung für Nordrhein-Westfalen zeigen: Antisemitismus ist für Jüdinnen und Juden Alltag in unserem Land. Viele Taten werden nicht zur Anzeige gebracht oder liegen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Das Dunkelfeld ist riesig. Landtag und Kabinett haben auf Grundlage dieser Erhebung die Mittel und den Rahmen für die Einrichtung einer solchen Meldestelle Antisemitismus für Nordrhein-Westfalen gegeben. Die Umsetzung in diesem Jahr erfolgt nun seitens des zuständigen Ressorts“, betonte die Antisemitismusbeauftragte. Die individuellen Eingaben, die das Büro der Antisemitismusbeauftragten 2020 erreichten, summierten sich auf 500. „Damit erreichten mich und meine Mitarbeiter deutlich mehr Eingaben als im Vorjahr“, sagte Leutheusser-Schnarrenberger.
In ihrem zweiten Amtsjahr konnte die Antisemitismusbeauftragte des Landes Nordrhein-Westfalen weitere Präventionsmaßnahmen und -projekte initiieren und durchführen. „Wir haben gemeinsam mit dem Schulministerium ein Projekt gestartet, das sich mit Antisemitismus im sozialem Kontext Schule befasst und auch unterrichtsbeobachtende Elemente vorsieht. Die Ruhr-Universität in Bochum ist stark in dieses Projekt eingebunden und hat ein Team von Forschenden zusammengestellt, die auf die Interaktionen im Unterricht achten, wenn es um Israel, um den Nahostkonflikt, um das Leben von Juden in Deutschland oder um die deutsche Geschichte, den Holocaust und die zersetzende Kraft des Antisemitismus geht. Daraus sollen dann auch Empfehlungen für den Unterricht entwickelt werden“, so Leutheusser-Schnarrenberger.
Eine weitere in 2020 maßgeblich erarbeitete und kürzlich vorgestellte Studie widmete sich dem Zusammenhang von Antisemitismus und dem Musikgenre Gangsta-Rap. „Hier haben wir erste empirische Befunde und müssen nun Methoden entwickeln, um auch in diesem Teil der Jugend- und Musikkultur antisemitischen Mustern entgegenzuwirken. Es hilft, wenn es dazu gutes Argumentationsmaterial gibt, es braucht aber mehr als die reine Wissensvermittlung. Junge Menschen überzeugt der erhobene Zeigefinger nicht, es braucht vielmehr die ganz konkrete Auseinandersetzung damit, was es für die Betroffenen bedeutet, beschimpft und beleidigt zu werden. Es muss nach Gründen für solch antisemitische Ausbrüche gesucht werden, denn oft ist das Umfeld dafür verantwortlich. Manche Schülerinnen und Schüler haben ein Umfeld, in dem die Vernichtung oder Dämonisierung Israels Alltag ist. In diesen Familien gehört Israel vielleicht gar nicht auf die Landkarte. Da müssen wir alle gegenhalten. Es dürfen solche Aussagen nicht unwidersprochen bleiben. Weder in der Schule noch im Alltag.“
„Das Festjahr anlässlich 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland hat in Nordrhein-Westfalen seinen Ausgangspunkt. Mit vielen Projekten und Formaten kann das ein Ausgangspunkt für neue Instrumente in der Arbeit gegen Antisemitismus sein“, so Leutheusser-Schnarrenberger. Für 2021 stünden daher Vorhaben und Projekte im Mittelpunkt der Arbeit, die strukturell jenen neuen Erscheinungsformen des Antisemitismus Rechnung tragen. „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in öffentlichen Berufen und in Verfassungsorganen müssen darin unterstützt werden, solche Formen zu erkennen. Überdies müssen Akteure mit breiten gesellschaftlichen Vorbildwirkungen – wie etwa der Sport – in die Präventions- und Sensibilisierungsarbeit eingebunden werden“, empfahl die Antisemitismusbeauftragte.
„Die jüngsten antisemitisch motivierten Vorfälle und Übergriffe in Nordrhein-Westfalen als Reaktion auf die Eskalation der Gewalt zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen verurteile ich auf das Schärfste“, betonte Leutheusser-Schnarrenberger. „Antisemitische Hetze und hinausgebrüllter Hass gegen Jüdinnen und Juden, Zerstörungen von Gedenkstätten in mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen sind durch nichts zu rechtfertigen. Wer hier seinen Hass gegen den aus seiner Sicht Erzfeind Israel ausleben will, wird wegen Volksverhetzung strafrechtlich verfolgt werden. Das Verbrennen von Flaggen des Staates Israel ist ausdrücklich strafbar. Wer das nicht einsehen will, der hat die Wertegrundlagen des Zusammenlebens in Deutschland nicht verstanden, dessen Integration ist schiefgelaufen.“
Hintergrund
Überfraktionell getragen, geht die Berufung der Antisemitismusbeauftragten auf den Antrag „Nordrhein-Westfalen braucht einen Antisemitismusbeauftragten“ der Landtagsfraktionen von CDU, SPD, FDP und Bündnis 90/Die Grünen vom 5. Juni 2018 zurück. Der Beschluss des Landtags Nordrhein-Westfalen zur Schaffung einer solchen Stelle wurde in der Plenarsitzung vom 14. Juni 2018 einstimmig gefasst.
Laut Beschluss des Landtags Nordrhein-Westfalen umfasst das Aufgabenspektrum der Antisemitismusbeauftragten, präventive Maßnahmen der Antisemitismusbekämpfung zu koordinieren und Ansprechpartnerin für Opfer antisemitischer Taten zu sein. Sie legt dem Landtag jährlich einen Bericht über ihre Arbeit vor, in dem sie Maßnahmen zur Bekämpfung des Antisemitismus empfiehlt.
Die Arbeit der Antisemitismusbeauftragten basiert auf drei Pfeilern: der Unvereinbarkeit von Antisemitismus mit Demokratie und Grundrechten, der Bedeutung des friedlichen Zusammenlebens der Religionen und der historischen Verantwortung gegenüber dem Judentum und dem Staat Israel. Grundlage ist die Arbeitsdefinition „Antisemitismus“ der IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance).
Das Amt wird als Ehrenamt ausgeübt. Die Antisemitismusbeauftragte ist funktional dem Geschäftsbereich des Ministerpräsidenten zugeordnet.
Alle Informationen über die Arbeit der Antisemitismusbeauftragten sind verfügbar unter: https://www.antisemitismusbeauftragte.nrw/













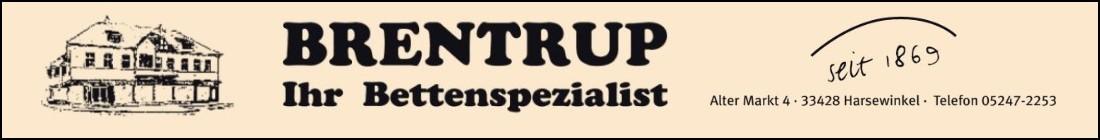



















 Eine schöne Wandertour macht mit der richtigen Bekleidung aus dem
Eine schöne Wandertour macht mit der richtigen Bekleidung aus dem 







 Bang, a Boomerang! – So titulierte die schwedische Popgruppe ABBA einen ihrer Welthits, an den sich der eine oder die andere noch erinnern wird. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere auch an die Ratssitzung vom 26.4.2016, in der eine Mehrheit von CDU und UWG die Ausweisung weiterer Vorrangflächen für Windkraftanlagen im Flächennutzungsplan ablehnte. Diese Entscheidung wurde damals als Erfolg gefeiert, Windräder auf Harsewinkeler Stadtgebiet wurden vermieden.
Bang, a Boomerang! – So titulierte die schwedische Popgruppe ABBA einen ihrer Welthits, an den sich der eine oder die andere noch erinnern wird. Vielleicht erinnert sich der eine oder die andere auch an die Ratssitzung vom 26.4.2016, in der eine Mehrheit von CDU und UWG die Ausweisung weiterer Vorrangflächen für Windkraftanlagen im Flächennutzungsplan ablehnte. Diese Entscheidung wurde damals als Erfolg gefeiert, Windräder auf Harsewinkeler Stadtgebiet wurden vermieden.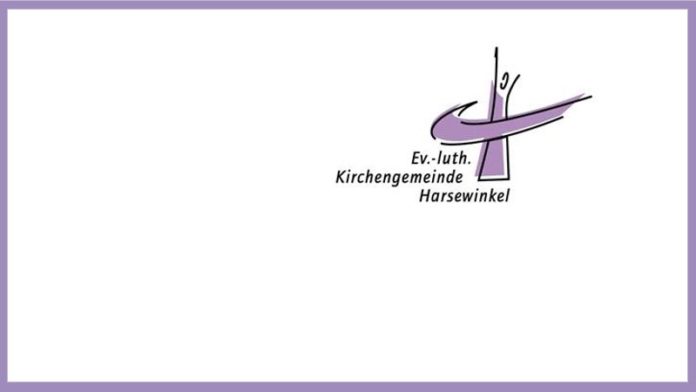
 Der evangelische Gottesdienst wird am Pfingstsonntag um 10.00 Uhr in der Martin-Luther-Kirche in Harsewinkel und am Pfingstmontag um 10.00 Uhr in der Christuskirche in Marienfeld gefeiert. Am Pfingstsamstag findet kein Abendgottesdienst in der Christuskirche in Marienfeld statt. Der Gottesdienst am Pfingstsonntag wird von fünf Mitgliedern des evangelischen Kirchenchors musikalisch begleitet.
Der evangelische Gottesdienst wird am Pfingstsonntag um 10.00 Uhr in der Martin-Luther-Kirche in Harsewinkel und am Pfingstmontag um 10.00 Uhr in der Christuskirche in Marienfeld gefeiert. Am Pfingstsamstag findet kein Abendgottesdienst in der Christuskirche in Marienfeld statt. Der Gottesdienst am Pfingstsonntag wird von fünf Mitgliedern des evangelischen Kirchenchors musikalisch begleitet.






 In den 146 Bürgertestzentren im Kreis Gütersloh wurden mehr als 200.000 Corona Testungen durchgeführt. Eine Zwischenbilanz: Die Testbereitschaft im Kreis wächst. Mitte Mai werden 41.500 Tests pro Woche verzeichnet, von denen 75 positiv ausgefallen sind. Das macht 0,1 Prozent der Testungen aus. Zum Vergleich wurden im April 18.800 Tests pro Woche durchgeführt, von denen 103 positiv ausfielen, was 0,5 Prozent der Tests ausmacht. Das zeigt, dass zurzeit mehr getestet wird und die positiven Ergebnisse seltener sind.
In den 146 Bürgertestzentren im Kreis Gütersloh wurden mehr als 200.000 Corona Testungen durchgeführt. Eine Zwischenbilanz: Die Testbereitschaft im Kreis wächst. Mitte Mai werden 41.500 Tests pro Woche verzeichnet, von denen 75 positiv ausgefallen sind. Das macht 0,1 Prozent der Testungen aus. Zum Vergleich wurden im April 18.800 Tests pro Woche durchgeführt, von denen 103 positiv ausfielen, was 0,5 Prozent der Tests ausmacht. Das zeigt, dass zurzeit mehr getestet wird und die positiven Ergebnisse seltener sind.


 Am langen Pfingstwochenende wird es die erste große Reisewelle des Jahres und damit deutlich mehr Staus als in den Vorwochen geben. Der ADAC erwartet wegen der anhaltenden Corona-Pandemie eine ähnliche Verkehrslage wie Pfingsten 2020: Viele Verkehrsstörungen – aber weit entfernt vom Niveau früherer Jahre vor Corona. Vor einem Jahr zählten die Experten von Freitag bis Pfingstmontag 3591 Staus bei einer Gesamtlänge von 5072 Staukilometern auf Autobahnen. Im Jahr 2019 hingegen waren es 5518 Staus mit einer Länge von 11.600 Kilometern. Das waren rund 35 Prozent weniger Staus als 2019.
Am langen Pfingstwochenende wird es die erste große Reisewelle des Jahres und damit deutlich mehr Staus als in den Vorwochen geben. Der ADAC erwartet wegen der anhaltenden Corona-Pandemie eine ähnliche Verkehrslage wie Pfingsten 2020: Viele Verkehrsstörungen – aber weit entfernt vom Niveau früherer Jahre vor Corona. Vor einem Jahr zählten die Experten von Freitag bis Pfingstmontag 3591 Staus bei einer Gesamtlänge von 5072 Staukilometern auf Autobahnen. Im Jahr 2019 hingegen waren es 5518 Staus mit einer Länge von 11.600 Kilometern. Das waren rund 35 Prozent weniger Staus als 2019. Das was? Na, das Spöggsken!
Das was? Na, das Spöggsken!