 Stecker-Solargeräte können einen wesentlichen Teil des Haushalts mit Strom versorgen. Eigenverbrauchsquote mit Speicherlösungen und optimierter Nutzung erhöhen. Solarpaket 1 erleichtert Anmeldung des Balkonkraftwerks. TÜV-Verband gibt Tipps zur Anmeldung und Installation von Stecker-Solargeräten.
Stecker-Solargeräte können einen wesentlichen Teil des Haushalts mit Strom versorgen. Eigenverbrauchsquote mit Speicherlösungen und optimierter Nutzung erhöhen. Solarpaket 1 erleichtert Anmeldung des Balkonkraftwerks. TÜV-Verband gibt Tipps zur Anmeldung und Installation von Stecker-Solargeräten.
Berlin, 27. August 2024 – Solaranlagen für Balkon, Terrasse oder Garten können sich langfristig finanziell lohnen und gleichzeitig einen Beitrag zur Energiewende leisten. Der selbst produzierte Strom boomt: Etwa 220.000 neue Anlagen registrierte die Bundesnetzagentur im ersten Halbjahr 2024. Zum Vergleich: Im Jahr 2023 wurden insgesamt rund 300.000 neue Balkonkraftwerke registriert. Für zusätzlichen Schub soll das im Mai von der Bundesregierung verabschiedete Solarpaket 1 sorgen, das es Bürger:innen erleichtert, ein Balkonkraftwerk zu installieren. „An sonnigen Tagen und bei optimaler Ausrichtung erzeugen Stecker-Solargeräte genug Strom, um einen erheblichen Teil des Haushaltsstrombedarfs zu decken“, sagt Dr. Hermann Dinkler, Energieexperte beim TÜV-Verband. „Ein Balkonkraftwerk mit einer Leistung von 800 Watt produziert unter optimalen Bedingungen circa 550 Kilowattstunden Strom im Jahr.“ Das entspricht etwa 40 Prozent des jährlichen Stromverbrauchs eines Einpersonenhaushalts. Entsprechende Beispielrechnungen bietet zum Beispiel die Hochschule HTW Berlin auf ihrer Website an. Der TÜV-Verband gibt Tipps für die Installation und Nutzung von Balkonkraftwerken.
Lohnt sich ein Speicher für überschüssigen Strom? – Ein Solarmodul erzeugt aus Sonnenenergie elektrischen Gleichstrom, der in einem Wechselrichter in Wechselstrom umgewandelt wird. Über ein Anschlusskabel und eine Außensteckdose fließt der selbst erzeugte Strom dann direkt ins Stromnetz der Wohnung. „Fließt der Solarstrom durch das Hausnetz, zählt der Stromzähler automatisch langsamer, weil weniger Strom aus dem öffentlichen Netz benötigt wird“, erläutert Dinkler.
Ohne Speicher können Haushalte durchschnittlich nur 55 bis 70 Prozent des erzeugten Stroms direkt nutzen. „In einer normalen Arbeitswoche deckt sich der Strombedarf oft nicht mit den Produktionsspitzen um die Mittagszeit“, sagt Dinkler. Haushalte, die überschüssigen Solarstrom in das öffentliche Netz einspeisen und dafür eine Vergütung erhalten wollen, müssen nach der aktuellen Gesetzeslage bestimmte Anforderungen erfüllen. Diese bürokratischen Hürden sind jedoch so hoch, dass es oft wirtschaftlich sinnvoller ist, den überschüssigen Strom kostenlos abzugeben.
Um dies zu vermeiden, bieten einige Unternehmen inzwischen Speicherlösungen an. Diese Batterien speichern den überschüssigen Solarstrom, der dann zu einem späteren Zeitpunkt für den Eigenbedarf genutzt werden kann. Solche Speicher sind entweder als Ergänzung zu bestehenden Balkonkraftwerken oder in Kombination mit neuen Anlagen erhältlich. Preislich beginnen kleinere Speicher mit einer Kapazität von weniger als einer Kilowattstunde bei etwa 400 Euro.
Für Haushalte mit kleinen Anlagen mit ein oder zwei Modulen lohnt sich ein Speicher oft nicht, da der überschüssige Strom gering ist. Bei größeren Anlagen mit vier oder fünf Modulen kann ein Speicher jedoch sinnvoll sein, insbesondere, wenn er günstig erworben wird. Unabhängig davon gibt es Möglichkeiten, den Eigenverbrauch auch ohne Speicher zu optimieren, zum Beispiel durch den gezielten Einsatz von Elektrogeräten in sonnenreichen Zeiten. Dafür können Verbraucher:innen Zeitschaltuhren nutzen und beispielsweise die Spülmaschine dann laufen lassen, wenn die Sonne mittags am stärksten ist.
Übrigens gibt es in den meisten Bundesländern öffentliche Förderungen für die Anschaffung und Installation von Stecker-Solargeräten. Die Mittel werden in der Regel über die Kommunen vor Ort ausgereicht. Eine Übersicht ist hier abrufbar.
Meldepflichten von Balkonkraftwerken deutlich vereinfacht – Das im Mai 2024 von der Bundesregierung verabschiedete Solarpaket 1 erleichtert Bürger:innen die Anmeldung von Balkonkraftwerken. Zuvor mussten Verbraucher:innen ihr Stecker-Solargerät bei der Bundesnetzagentur im Marktstammdatenregister und beim lokalen Stromnetzbetreiber anmelden. Seit der Verabschiedung des Gesetzespakets entfällt die Meldepflicht für Balkonkraftwerke beim Netzbetreiber. Die Registrierung im Marktstammdatenregister beschränkt sich nun auf wenige, einfach zu erfassende Daten und ist unter www.marktstammdatenregister.de möglich.
Der Betrieb eines Balkonkraftwerks mit einem Stromzähler ohne Rücklaufsperre war bisher verboten. Eine neue Richtlinie im Solarpaket 1 erlaubt nun den befristeten Einsatz von rückwärtslaufenden Stromzählern. Ferraris-Zähler und andere analoge Zähler ohne Rücklaufsperre müssen innerhalb von vier Monaten nach Inbetriebnahme durch den Messstellenbetreiber gegen einen Zweirichtungszähler oder einen modernen, digitalen Stromzähler (Smart Meter) ausgetauscht werden. Der Austausch erfolgt automatisch und muss nicht gesondert beauftragt werden.
Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) legt fest, dass Stecker-Solargeräte eine maximale Modulleistung von 2.000 Watt haben dürfen, um vereinfacht bei der Bundesnetzagentur registriert werden zu können. Wichtig ist, dass die Leistung des Wechselrichters dabei auf höchstens 800 Watt begrenzt ist, sodass nicht mehr Strom in das Stromnetz eingespeist wird.
Auf sachgemäße Montage achten – Verbraucher:innen sollten vor dem Kauf überprüfen, ob ihre Wohnung den Anforderungen an die Aufstellung und den Anschluss eines Stecker-Solargeräts entspricht. Damit die Sonne die Solarzellen optimal bestrahlen kann, sind Wohnungen mit einem zur Sonne ausgerichteten Balkon, einer Terrasse, einer Dachfläche oder einer Außenwandfläche am besten geeignet. Ungeeignet für die Montage sind zum Beispiel schattige Plätze hinter der Balkonbrüstung, an der Wand direkt unter dem Balkon der darüber liegenden Etage oder Stellen mit ständiger Verschattung. Außerdem sollte sich in unmittelbarer Nähe des Solargeräts eine Außensteckdose befinden, um den erzeugten Strom aufnehmen zu können.
Balkonkraftwerke bestehen aus mehreren Komponenten: Ein bis zwei Solarmodule: Die Nennleistung eines Moduls beträgt etwa 300 Watt. Für Balkonbrüstungen eignen sich leichtere Solarmodule mit einer Leistung von 50 bis 150 Watt. Auf eine ausreichende mechanische Stabilität der Brüstung ist dennoch zu achten.
Wechselrichter, der entweder in das Solarmodul integriert oder separat montiert ist. Die Anschlussleistung des Wechselrichters darf 800 Watt nicht überschreiten.
Anschlusskabel, das vom Wechselrichter zu einer geeigneten Außensteckdose führt.
Schuko-Stecker: Balkonkraftwerke kommen mit einem handelsüblichen Schuko-Stecker aus. Der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE) empfiehlt die Verwendung eines speziellen „Einspeise-Steckers“ nach DIN-Norm VDE 0100-551. Dieser kommt in der Praxis bei etwa 80 Prozent der Stecker-Solargeräte zum Einsatz.
„Optional kann ein passendes Strommessgerät für die Funktionskontrolle angebracht werden. So können Verbraucher:innen überprüfen, ob das Stecker-Solargerät funktioniert und nachmessen, wie viel Strom produziert wird“, sagt Dinkler.
Ob auf dem Balkon, auf der Terrasse oder an der Hauswand, Balkonkraftwerke müssen mit geeignetem Montagematerial sicher befestigt werden. Denn die Solaranlage muss Wind und Wetter standhalten und darf keinesfalls herabfallen. „Beim Anbringen von Stecker-Solargeräten ist deshalb besondere Sorgfalt geboten“, sagt Dinkler. „Es gibt unterschiedliche Halterungen für Balkonbrüstungen, Fassaden oder Dächer. Verbraucher:innen sollten darauf achten, dass die Bauteile zum jeweiligen Montageort passen und vom Hersteller mitgeliefert werden.“ Achtung: Bei der Anbringung an Außenwänden darf die Fassadendämmung nicht beschädigt werden. Grundsätzlich gilt: Verbraucher:innen sollten die Bedienungsanleitung sorgfältig lesen und die angegebenen Montagehinweise unbedingt beachten.
Sicherheitshinweise beachten – Stecker-Solargeräte gelten grundsätzlich als sicher. Ein erhöhtes Brandrisiko besteht im Vergleich zu anderen technischen Anlagen nicht, sofern die Montage sachgemäß erfolgt. „Es sollte immer nur ein Solargerät an eine Steckdose beziehungsweise einen Stromkreis angeschlossen werden. Niemals sollten mehrere Solargeräte an eine Mehrfachsteckdose angeschlossen werden, um eine Überlastung und damit einen möglichen Schwelbrand von Steckdose oder Stromleitungen zu vermeiden“, sagt Dinkler.
Eine spezielle Produktnorm für Stecker-Solargeräte gibt es derzeit noch nicht. Die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie DGS hat den Sicherheitsstandard DGS 0001:2019-10 für Stecker-Solargeräte eingeführt, der bereits einige sicherheitsrelevante Aspekte festgelegt, die voraussichtlich in die kommende Produktnorm integriert werden sollen. Diese neue Norm wird unter der Bezeichnung DIN VDE V 0126-95 geführt, ihre Fertigstellung sowie Veröffentlichung wird für Ende 2024 erwartet.
Über den TÜV-Verband: Als TÜV-Verband e.V. vertreten wir die politischen Interessen der TÜV-Prüforganisationen und fördern den fachlichen Austausch unserer Mitglieder. Wir setzen uns für die technische und digitale Sicherheit sowie die Nachhaltigkeit von Fahrzeugen, Produkten, Anlagen und Dienstleistungen ein. Grundlage dafür sind allgemeingültige Standards, unabhängige Prüfungen und qualifizierte Weiterbildung. Unser Ziel ist es, das hohe Niveau der technischen Sicherheit zu wahren, Vertrauen in die digitale Welt zu schaffen und unsere Lebensgrundlagen zu erhalten. Dafür sind wir im regelmäßigen Austausch mit Politik, Behörden, Medien, Unternehmen und Verbraucher:innen.
(Text- und Bildquelle: TÜV-Verband e. V.)












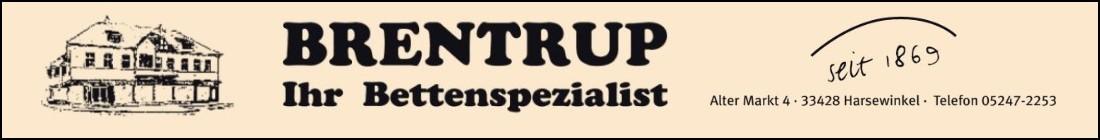



















 Im Rahmen der jährlichen Herbst RTF, die in diesem Jahr unter dem neuen Namen „Die Mähdreschertour“ veranstaltet wird, bietet die
Im Rahmen der jährlichen Herbst RTF, die in diesem Jahr unter dem neuen Namen „Die Mähdreschertour“ veranstaltet wird, bietet die 


 Zu einem atmosphärischen Abend mit romantischen, unheimlichen, vergnüglichen und verrückten Geschichten und Lyrik aus dem französischen Raum, laden Volkshochschule, Stadtbücherei St. Lucia und KÖB St. Marien am Donnerstag, den 26. September ab 19 Uhr ein.
Zu einem atmosphärischen Abend mit romantischen, unheimlichen, vergnüglichen und verrückten Geschichten und Lyrik aus dem französischen Raum, laden Volkshochschule, Stadtbücherei St. Lucia und KÖB St. Marien am Donnerstag, den 26. September ab 19 Uhr ein.
 Der Sommer ist zurück und verwöhnt uns mit tollem Wetter. Passende Gelegenheit bei Cocktails, coolen Drinks, Grillklassikern und mehr den Samstagabend im schönen Innenhof vom Kulturort Wilhalm ausklingen zu lassen.
Der Sommer ist zurück und verwöhnt uns mit tollem Wetter. Passende Gelegenheit bei Cocktails, coolen Drinks, Grillklassikern und mehr den Samstagabend im schönen Innenhof vom Kulturort Wilhalm ausklingen zu lassen.
 Stecker-Solargeräte können einen wesentlichen Teil des Haushalts mit Strom versorgen. Eigenverbrauchsquote mit Speicherlösungen und optimierter Nutzung erhöhen. Solarpaket 1 erleichtert Anmeldung des Balkonkraftwerks. TÜV-Verband gibt Tipps zur Anmeldung und Installation von Stecker-Solargeräten.
Stecker-Solargeräte können einen wesentlichen Teil des Haushalts mit Strom versorgen. Eigenverbrauchsquote mit Speicherlösungen und optimierter Nutzung erhöhen. Solarpaket 1 erleichtert Anmeldung des Balkonkraftwerks. TÜV-Verband gibt Tipps zur Anmeldung und Installation von Stecker-Solargeräten.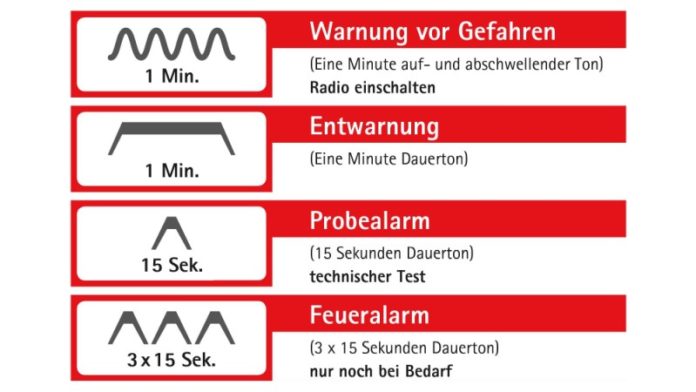
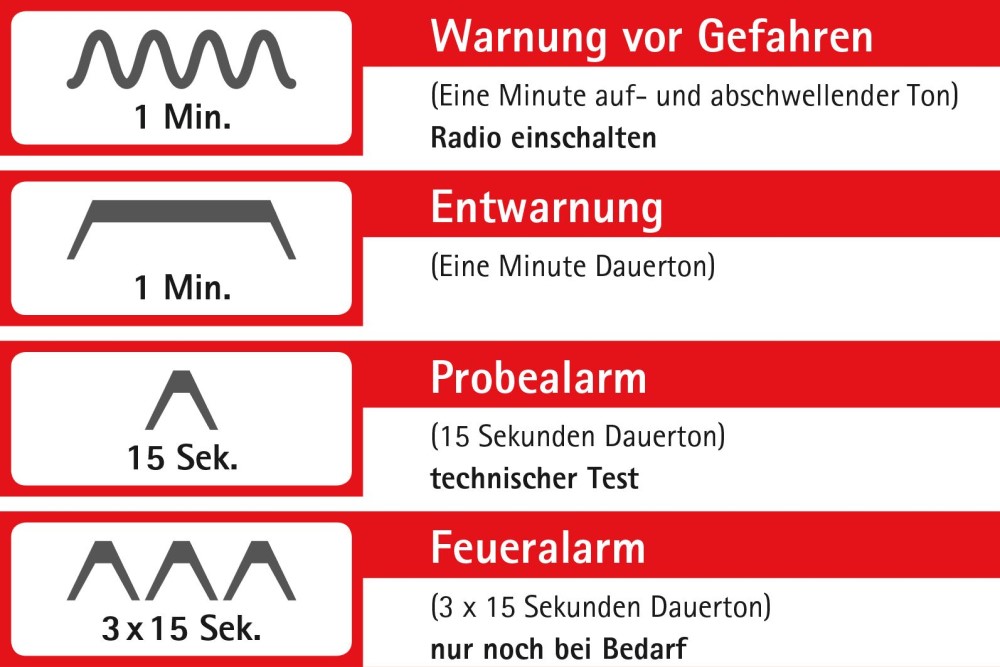
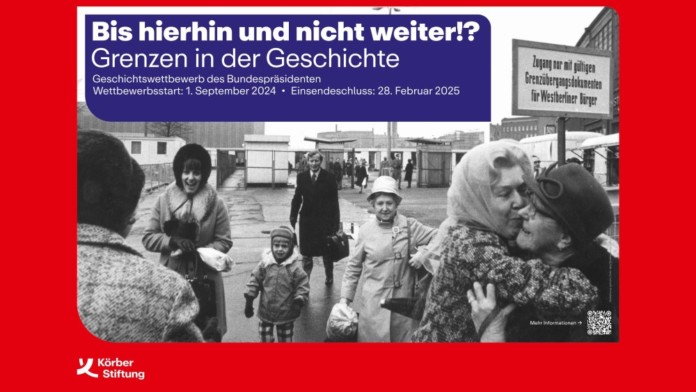
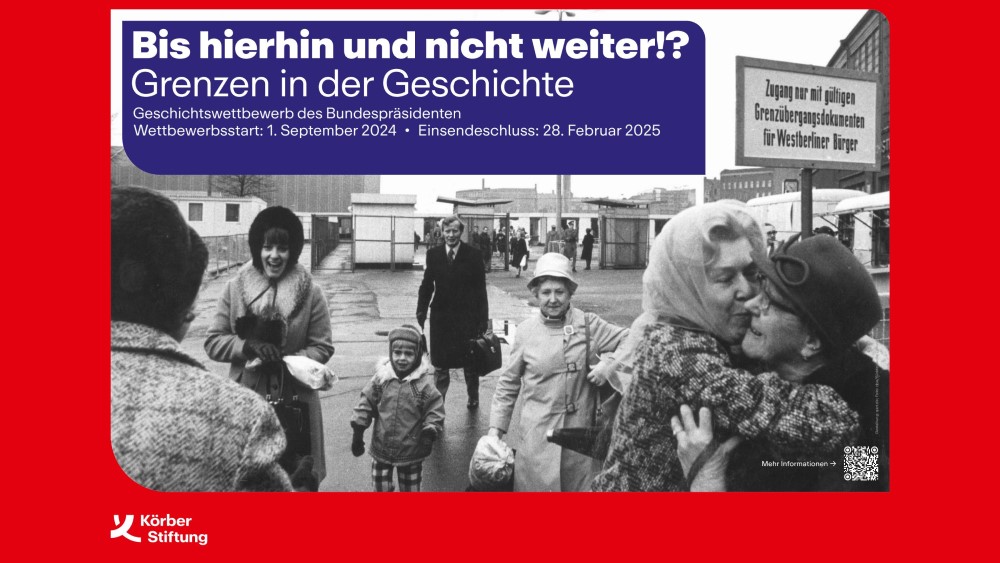

 Die evangelische Kirchengemeinde Harsewinkel lädt am Samstagabend, 7.9.24, um 18 Uhr zum Spätlese-Gottesdienst in die Christuskirche in Marienfeld ein. Das Thema lautet: „Weite suchen“. In der abendlicher Atmospäre wird der Spätlesegottesdienst Gedanken zu dieser Themenüberschrift aufnehmen und zur Sprache bringen. Die Worte werden dabei, wie für den Spätlesegottesdienst gewohnt, mit passenden Bildern gerahmt und begleitet.
Die evangelische Kirchengemeinde Harsewinkel lädt am Samstagabend, 7.9.24, um 18 Uhr zum Spätlese-Gottesdienst in die Christuskirche in Marienfeld ein. Das Thema lautet: „Weite suchen“. In der abendlicher Atmospäre wird der Spätlesegottesdienst Gedanken zu dieser Themenüberschrift aufnehmen und zur Sprache bringen. Die Worte werden dabei, wie für den Spätlesegottesdienst gewohnt, mit passenden Bildern gerahmt und begleitet.
 Putzen nach Plan, energieeffizient kochen und wirksam Flecken entfernen – in
Putzen nach Plan, energieeffizient kochen und wirksam Flecken entfernen – in 

 Das was? Na, das Spöggsken!
Das was? Na, das Spöggsken!